Bistum Fulda
Geschichte des Bistums
von Prof. Josef Leinweber


 |
Im Jahr 744 ließ Bonifatius durch seinen Schüler Sturmius das Kloster Fulda an dem Ort, der ihm wohl schon länger bekannt war, gründen und 751 durch Papst Zacharias von jeder bischöflichen Gewalt befreien und unmittelbar dem römischen Stuhl unterstellen. Von nicht geringer Bedeutung für die spätere Entwicklung war der Umstand, daß das Kloster Fulda nicht von einem Bistum eingeschlossen wurde, sondern genau an der Grenzlinie zwischen dem Bistum Mainz und dem ebenfalls von Bonifatius gegründeten Bistum Würzburg lag; der Flußlauf der Fulda bildete ja in diesem Bereich seit alters bis zur Entstehung des Bistums Fulda die mainzwürzburgische Diözesangrenze.
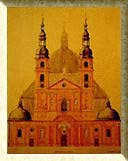 |
Dazu kam neben der hervorragenden politischen Stellung des Fuldaer Abtes im Hochmittelalter, welche selbst die mancher Bischöfe im Reich übertraf, noch der Umstand, daß der Abt für die meisten der etwa 70 Pfarreien eines Herrschaftsgebietes das Besetzungsrecht hatte. Dagegen hatte der Bischof von Würzburg in dem Teil der Abtei Fulda, der seiner Geistlichen Hoheit unterstand, nur drei Pfarreien, der Erzbischof von Mainz im fuldischen Teil seines Bistums sogar überhaupt keine Pfarreien zu besetzen. Der Abt besaß zudem schon sehr früh einen eigenen Weltklerus in den etwa 40 Chorherren der von ihm abhängigen Kollegiatstifte Hünfeld, Rasdorf und Salmünster, die an der Befreiung des Klosters Fulda von der bischöflichen Gewalt teilhatten.So war das Kloster Fulda von Anfang an geeignet, sich mit dem zu ihm gehörigen Umland wie ein Keil zwischen die beiden Bistümer Mainz und Würzburg zu schieben und eines Tages selbst zum Bistum zu werden. Im Spätmittelalter kamen, begünstigt durch päpstliche und bischöfliche Schismen in Mainz und Würzburg, die landeskirchlichen Bestrebungen des Fuldaer Fürstabtes hinzu. Er beanspruchte die geistliche 0berhoheit über seine Untertanen aufgrund seiner Verantwortung als Landesherr. Waren um 1500 bereits die Rechte der beiden zuständigen Bischöfe von Mainz und Würzburg weitgehend ausgeschaltet, so versuchte der Abt von Fulda in den Jahren von 1531 1533 in Rom die endgültige Loslösung seines Herrschaftsgebietes von der seitherigen Diözesanzugehörigkeit durch formelle Erhebung der Abtei zum Bistum zu erreichen. Als die Verhandlungen am Widerstand des Bischofs von Würzburg scheiterten, ging der Abt auf dem Tatsachenweg vor.
.
Von der Mitte des 16. Jahrhunderts an nahm der Abt von Fulda die Stellung eines QuasiBischofs ein. 1572 gründete er ein eigenes Priesterseminar in Fulda, im 17. Jahrhundert berief er wiederholt Diözesansynoden ein, visitierte die Pfarreien seines Herrschaftsgebietes, d. h. er setzte Akte, die nur einem Bischof vorbehalten sind. 1727 erreichte er es in Rom, daß ein Mönch seines Klosters Weihbischof wurde. Als dessen Nachfolger 1737 selbst Abt wurde, waren geistliche und weltliche Hoheit in einer Hand, so daß es nur noch eine Formsache war, als Papst Benedikt XIV. am 05.10.1752 die bisherige Abtei Fulda zum Bistum erhob. Die Wirren der Französischen Revolution brachten auch für das Bistum Fulda erhebliche Veränderungen. Zwar wurde es nicht aufgehoben, doch wurde es 1821 neu umschrieben. Dabei verlor es den inzwischen zu Bayern gehörenden Teil an das Bistum Würzburg, erhielt jedoch neben den wenigen katholischen Pfarreien um Amöneburg und Fritzlar, des Freigerichts, Bieber und Joßgrundes und bei Hanau die weiten Diasporagebiete des Kurfürstentums Hessen. 1857 wurden die katholischen Gläubigen des Großherzogtums SachsenWeimar dem Bistum Fulda unterstellt.
Nach kleineren Veränderungen der Bistumsgrenzen im Lauf des 19. Jahrhunderts brachte die Ausführungsbulle zu dem Konkordat, das 1929 zwischen Preußen und dem Hl. Stuhl geschlossen wurde, Veränderungen von weit größerer Bedeutung. Das Bistum verlor dabei den ehemals kurhessischen Teil von Frankfurt / Main, der etwa drei Viertel des heutigen Stadtgebietes von Frankfurt ausmacht, an das Bistum Limburg und erhielt dafür vom Bistum Paderborn das überwiegend katholische Kommissariat Heiligenstadt und das weiträumige Dekanat Erfurt mit einem Katholikenanteil von 3,72 Prozent. Eine Folge der Wiedervereinigung Deutschlands war die Neuordnung der Bistumsgrenzen. Während ein wesentlicher Anteil des ehemaligen "Ostteils der Diözese" im 1994 neuerrichteten Bistum Erfurt aufging, verblieb das Dekanat Geisa beim Bistum Fulda. Seine Pfarreien sind durch eine vielhundert, ja zum Teil über tausendjährige gemeinsame Geschichte sehr eng mit dem ehemaligen Hochstift und späteren Bistum Fulda verbunden. In den vergangenen Jahren hat sich die Diözese hier besonders auf dem baulichen und sozialen Sektor stark engagiert.

















Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578




Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578





© Bistum Fulda



